Schlaganfall: Neue Studie zeigt Mechanismen zur Erholung des Sprachvermögens
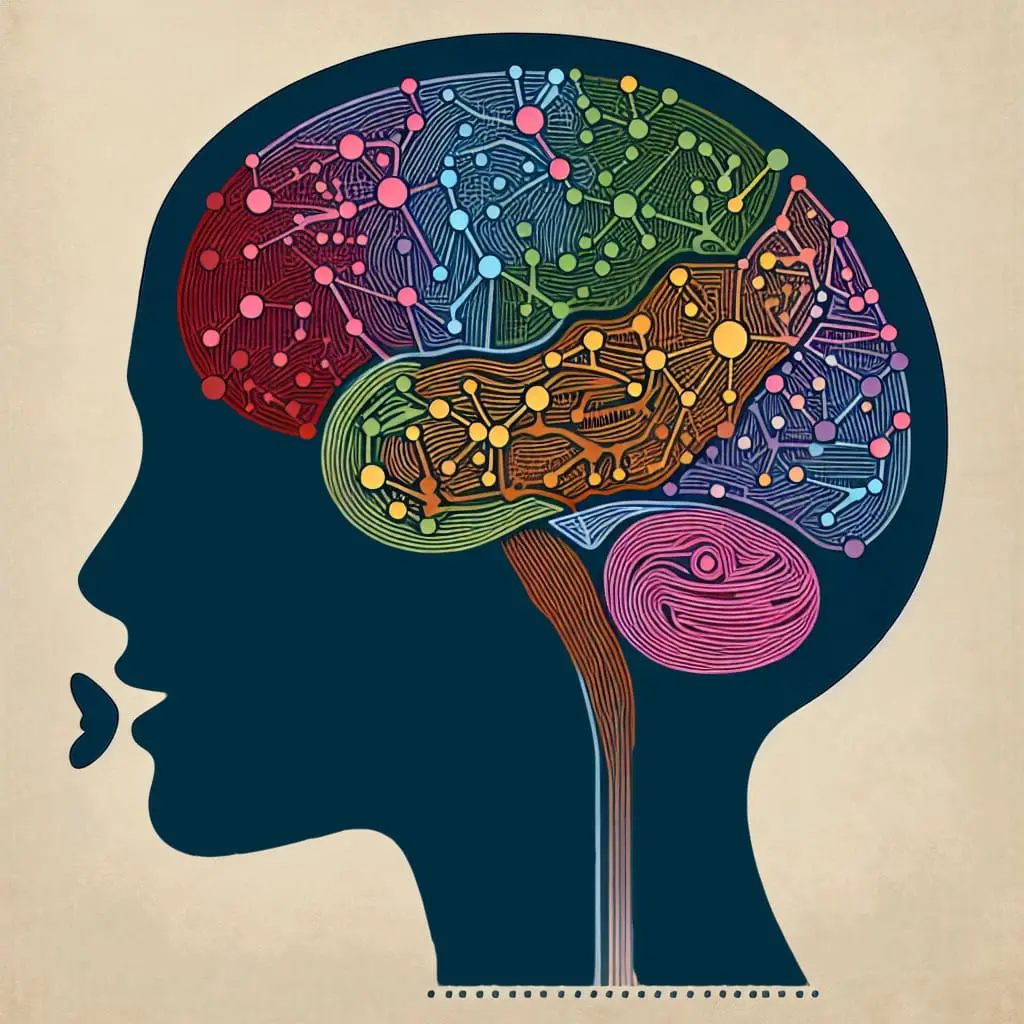
Eine aktuelle Studie zeigt, wie sich das Gehirn in den ersten Monaten nach einem Schlaganfall reorganisiert, um das Sprachvermögen wieder zu verbessern. Die Erkenntnisse helfen, die Funktionsweise von funktionellen Netzwerken im Gehirn besser zu verstehen. Sie bergen zudem das Potential, in weiterer Zukunft in der personalisierten Therapie nach einem Schlaganfall zum Einsatz zu kommen. Das haben Forschende des Wilhelm-Wundt-Instituts für Psychologie der Universität Leipzig, des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften, des Universitätsklinikums Leipzig und der Universität Cambridge herausgefunden.
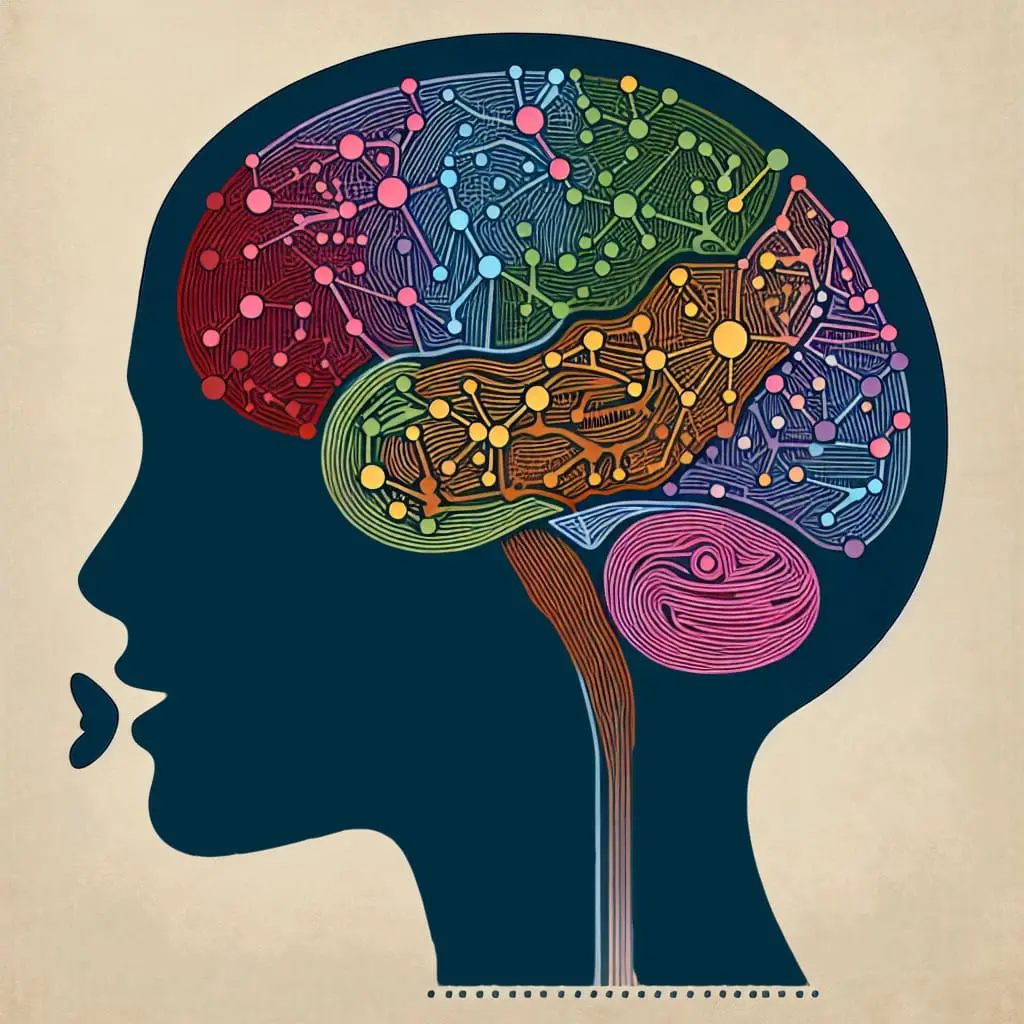
Nach einem Schlaganfall ist häufig das Sprachvermögen eingeschränkt. In vielen Fällen erholt es sich bis zu einem gewissen Grad in den Tagen und Wochen danach, denn das Gehirn versucht selbstständig, durch eigene Anstrengungen und logopädische Sprachtherapie das Sprachvermögen soweit möglich wieder herzustellen. Welche Prozesse bei der Spracherholung genau greifen, war bislang nicht bekannt.
„In unserer Studie haben wir Schlaganfall-Patienten der Universitätsklinik über drei Phasen hinweg untersucht: direkt nach dem Schlaganfall und dann zwei Wochen und ein halbes Jahr danach“, erläutert Autorin Prof. Dr. Gesa Hartwigsen vom Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig und vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Während frühere Studien sich auf die Aktivität „klassischer“ Sprachzentren im Gehirn konzentrierten, gingen die AutorInnen der vorliegenden Studie einen Schritt weiter: Sie untersuchten erstmals die Interaktionen zwischen verschiedenen Hirnbereichen, Areale genannt, auf Netzwerkebene. „Denn an Sprache sind viele Hirnareale beteiligt, die funktionelle Netzwerke bilden“, so die Wissenschaftlerin. „Wie genau diese Hirnareale während der Spracherholung zusammenarbeiten und sich gegenseitig beeinflussen, war allerdings noch unklar.“
Die AutorInnen der Studie stellten drei Prinzipien fest: „Erstens erhalten sprachspezifische Netzwerkareale der linken Gehirnhälfte, die durch den Schlaganfall betroffen sind, bereits sehr schnell funktionelle Verstärkung von anderen Netzwerkarealen“, berichtet Hartwigsen. „Diese ‚domänen-allgemeinen‘ Areale sind in beiden Seiten des Gehirns vorhanden und nehmen hier kognitive Stützfunktionen wahr.“ Zweitens, so fanden die WissenschaftlerInnen heraus, „springen die spiegelbildlich angelegten Bereiche der rechten Gehirnhälfte ein, die normalerweise weniger in der Sprachverarbeitung involviert sind als die der durch den Schlaganfall beschädigten linken Seite“, erläutert Dr. Philipp Kuhnke. Diese spiegelbildlich angelegten Bereiche nennt man auch Homologe. „Und drittens konnten wir sehen, dass sich bei der Spracherholung auch die Netzwerkkommunikation zwischen den Spracharealen in der linken Hirnhälfte wieder intensiviert“, so der Wissenschaftler.
Die funktionellen Anpassungsprozesse zur Wiedergewinnung eingebüßter Sprachkompetenz wandelten sich bei den Patienten über mehrere Monate hinweg teils stark. Wie dies geschah, hing unter anderem davon ab, ob sich das vom Schlaganfall beschädigte Gewebe bei Patienten im vorderen oder im hinteren Teil der linken Gehirnhälfte befand. Da sich die Verteilung sprachspezifischer Areale bei Rechtshänder und Linkshänder unterscheidet, wurden ausschließlich Rechtshänder untersucht, die einen Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte erlitten hatten.
Insgesamt wurden 51 Proband – 34 Patienten sowie 17 gesunde Kontrollprobanden – an der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Universitätsklinik Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Dorothee Saur untersucht. Während sich diese mit Sprachaufgaben beschäftigten, wurde ihre Hirnaktivität mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) gemessen. Anschließend werteten die Forscher die Daten mit einem Modellierungsverfahren aus, das kausale Zusammenhänge berücksichtigt. Das Verfahren erlaubt es, die Richtung der Netzwerkkommunikation zwischen verschiedenen Hirnarealen zu bestimmen. „Durch unsere Methode konnten wir nicht nur feststellen, welche Bereiche gleichzeitig aktiviert sind, sondern auch, welcher Teil welchen anderen in welcher Erholungsphase beeinflusst“, erläutert Dr. Philipp Kuhnke.
„Die Erkenntnisse bergen das Potential, in Zukunft Patientinnen und Patienten individuell therapieren zu können, etwa mit einer gezielten Neurostimulation“, so Prof. Dr. Gesa Hartwigsen. Doch bis dahin müsse noch weiter geforscht werden, mit noch mehr Probanden sowie umfangreicheren und detaillierteren Analysen. Parallel arbeiten die Wissenschaftler daran, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, mit denen sich eine gute Spracherholung nach einem Schlaganfall bereits kurz nach dem Ereignis prognostizieren lässt.
Originalpublikation
Lesen Sie auch
Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall kann vorausberechnet werden – MedLabPortal
Redaktion: X-Press Journalistenbürö GbR
Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.




