Polioviren im Abwasser bedrohen Kinder unter fünf Jahren

In mehreren deutschen Städten sind Polioviren im Abwasser nachgewiesen worden, was das Robert Koch-Institut (RKI) und die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) zu verstärkten Warnungen vor Impflücken veranlasst. Die Erreger, bekannt als zirkulierende impfstoffassoziierte Polioviren Typ 2 (cVDPV2), stammen von mutierten Impfviren, die wieder krankmachend werden können, insbesondere bei Menschen ohne ausreichenden Impfschutz. Obwohl Experten kein Risiko für eine flächendeckende Ausbreitung sehen, halten sie eine lokale Übertragung für zunehmend wahrscheinlich. Besonders gefährdet sind Kinder unter fünf Jahren und immungeschwächte Erwachsene. Die DGN und das RKI fordern dringend, den Impfstatus zu überprüfen und Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen zu verstärken, um das Risiko einer Infektion mit der gefürchteten Kinderlähmung zu minimieren.
Poliomyelitis, umgangssprachlich Kinderlähmung, ist eine hochansteckende Virusinfektion, die das zentrale Nervensystem angreifen und zu dauerhaften Lähmungen führen kann. Die jetzige Situation sei zwar ein Rückschlag, aber die Immunisierung sei in Deutschland so hoch, dass man keine Endemie befürchten müsse, erklärt Prof. Dr. Uta Meyding-Lamadé, Mitglied der DGN-Kommission Neuroinfektiologie und stellvertretende Vorsitzende der Nationalen Poliokommission des RKI. Dennoch warnt sie: „Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass sich Kinder ohne Impfschutz sowie immungeschwächte Erwachsene ohne Impfschutz nun auch wieder in Deutschland mit Polioviren infizieren könnten.“ Die Nachweise im Abwasser, die seit Ende 2024 in Städten wie München, Dresden, Hamburg, Köln, Bonn, Düsseldorf, Mainz, Berlin und Stuttgart erbracht wurden, deuten darauf hin, dass das Virus lokal zirkuliert, vermutlich durch Mensch-zu-Mensch-Übertragung.
Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Schmierinfektion, bei der die Viren über den Stuhl ausgeschieden und über kontaminierte Hände oder Oberflächen weitergegeben werden. „Die Viren werden mit dem Stuhl ausgeschieden – und oft mit der Klinke in die Hand gegeben. Regelmäßiges Händewaschen und Handdesinfektionen minimieren das Übertragungsrisiko“, betont das RKI. Eine Infektion verläuft in den meisten Fällen symptomlos, doch bei etwa einem von 200 Infizierten können schwere neurologische Komplikationen auftreten. Die Erkrankung durchläuft drei Phasen: Zunächst treten Fieber und Kopfschmerzen auf, gefolgt vom paralytischen Stadium mit typischen asymmetrischen Lähmungen durch eine Schädigung des Rückenmarks. Im Reparaturstadium bilden sich diese Lähmungen oft nur unvollständig zurück. „Gut ein Drittel der Betroffenen trägt schwere, dauerhafte Lähmungen davon“, sagt DGN-Generalsekretär Prof. Dr. Peter Berlit. Spätfolgen wie das Post-Polio-Syndrom mit Fatigue und Schmerzen oder eine spinale Muskelatrophie erhöhen das Risiko weiterer Lähmungen.
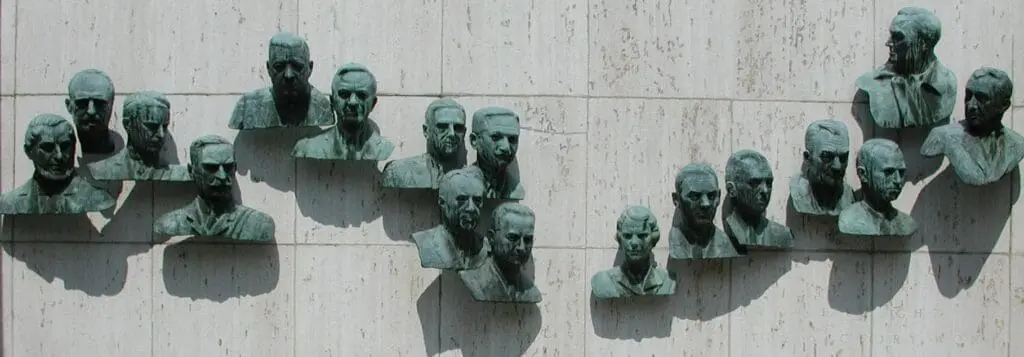
Die cVDPV2-Variante, die im Abwasser gefunden wurde, stammt von der oralen Schluckimpfung (OPV), die in Deutschland seit 1998 nicht mehr verwendet wird, aber in einigen Ländern weiterhin eingesetzt wird. Diese abgeschwächten Impfviren können sich bei niedrigen Impfquoten in der Bevölkerung verbreiten, genetisch verändern und wieder pathogen werden. Das RKI vermutet, dass die Viren durch Reisende aus Regionen wie Afrika, wo cVDPV2 seit 2020 zirkuliert, eingeschleppt wurden. „In Anbetracht der langen Dauer des Geschehens und der Nachweise von cVDPV2 an verschiedenen Standorten erscheint es zunehmend wahrscheinlicher, dass zumindest lokal begrenzt eine Übertragung von cVDPV2 zwischen Menschen stattfindet“, erklärt das RKI in seinem Epidemiologischen Bulletin.
Die Impfung bleibt der effektivste Schutz. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Grundimmunisierung für Säuglinge im Alter von 2, 4 und 11 Monaten sowie eine Auffrischimpfung zwischen 9 und 16 Jahren. Erwachsene ohne vollständige Grundimmunisierung sollten diese nachholen, wobei drei Dosen im Abstand von mindestens sechs Monaten zwischen der zweiten und dritten Impfung erforderlich sind. „Wichtig sei es, den Impfschutz von Kindern zu überprüfen. Es gebe immer wieder Fälle, in denen aus verschiedensten Gründen Impftermine nicht wahrgenommen werden und die Kinder nicht ausreichend geschützt seien“, sagt Meyding-Lamadé. Besonders alarmierend: Laut RKI sind nur 21 Prozent der einjährigen Kinder vollständig mit drei Impfdosen geschützt, weit unter der angestrebten Impfquote von 95 Prozent.
Immungeschwächte Erwachsene, etwa durch Immunsuppressiva oder Erkrankungen wie Leukämie, sind ebenfalls gefährdet. „Es besteht kein Grund zur Panik, denn Erwachsene infizieren sich sehr viel seltener und es kommt nur in Ausnahmefällen zu schweren Verlaufsformen. Dennoch sollten Ungeimpfte dieser Risikogruppe eine Vakzinierung in Erwägung ziehen“, rät Meyding-Lamadé. Besonders vulnerable Gruppen wie Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften oder Menschen aus Krisengebieten, wo Impfprogramme durch Konflikte wie in Gaza oder der Ukraine unterbrochen sind, sollten ihren Impfstatus prüfen.
Die Therapiemöglichkeiten bei einer Polio-Erkrankung sind stark begrenzt. „In Frage kommt lediglich die Gabe von Immunglobulinen, doch die Wirksamkeit ist bisher noch nicht ausreichend belegt. Das macht deutlich, wie wichtig die Prophylaxe durch die Impfung ist“, betont Berlit. Das Abwassermonitoring hat sich als effektives Frühwarnsystem erwiesen, doch die Funde zeigen, dass Wachsamkeit geboten ist. „Zwar haben wir keine bedenkliche Situation in Deutschland, aber wir sehen nun wieder Hinweise auf ein Virus, von dem wir annahmen, dass es bei uns ausgerottet ist. Daher müssen wir den Schutz vulnerabler Gruppen stärken“, sagt Meyding-Lamadé. Neben Impfungen bleibt gründliche Handhygiene eine einfache, aber wirksame Maßnahme, um die Verbreitung von Polioviren einzudämmen.
Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR
Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.




