LMU-Forscher ermöglichen PET-Nachweis von Synapsenverlust bei Multipler Sklerose
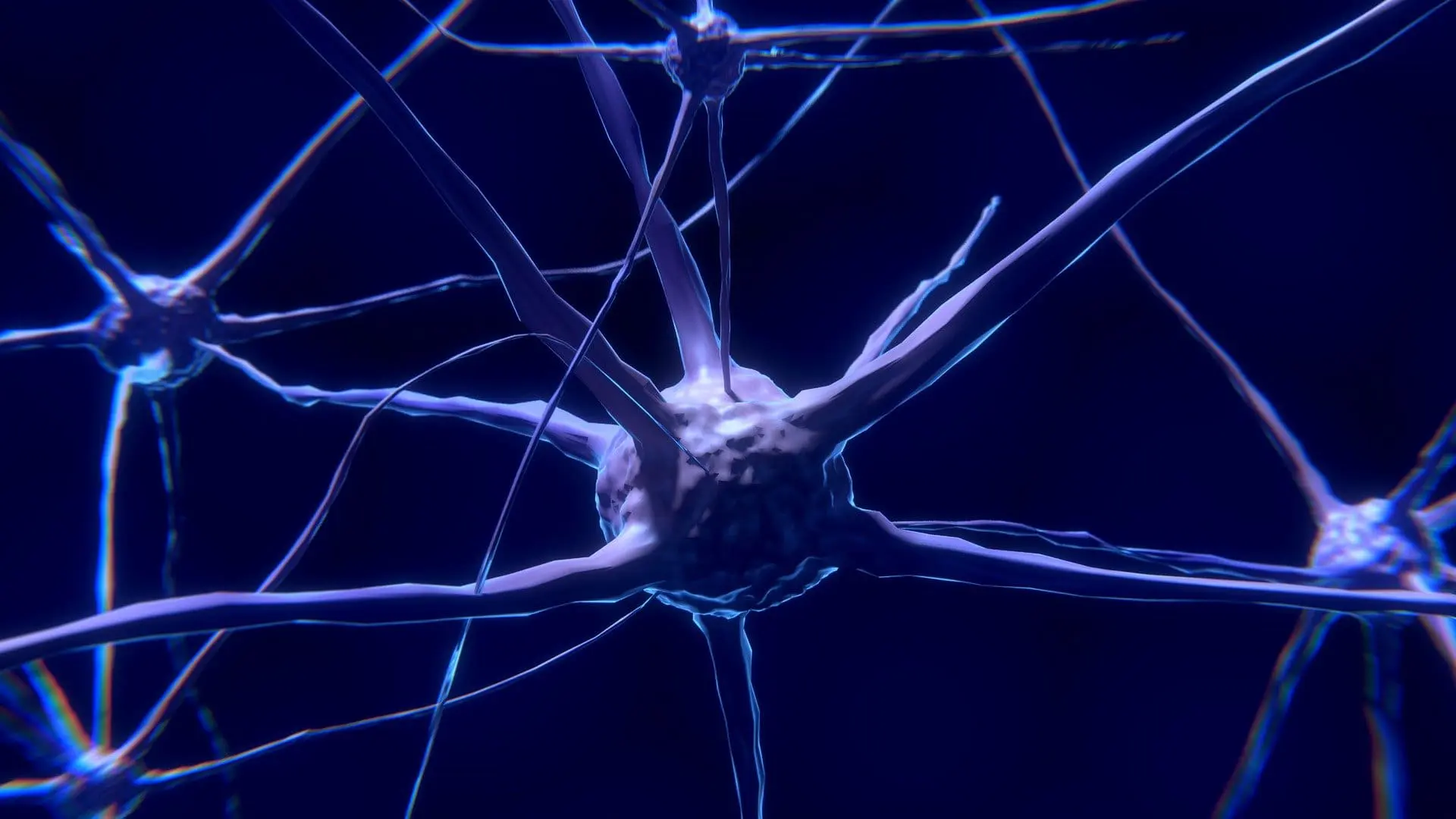
In Deutschland erkranken rund 250.000 Menschen an Multipler Sklerose, einer Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem Strukturen des zentralen Nervensystems angreift. Diese Attacken betreffen auch die graue Substanz im Gehirn, die aus Nervenzellkörpern und Synapsen besteht und als zentrales Verarbeitungszentrum fungiert. Bisher fehlte eine zuverlässige Methode, um pathologische Läsionen in dieser grauen Substanz nachzuweisen. Nun haben Forscher am LMU Klinikum erstmals demonstriert, dass die Positronen-Emissions-Tomografie den Synapsenverlust in den Läsionen der Großhirnrinde abbilden kann.
Langfristig streben die Forscher unter Leitung von Matthias Brendel von der Klinik für Nuklearmedizin und Martin Kerschensteiner vom Institut für Klinische Neuroimmunologie an, das Verfahren so weiterzuentwickeln, dass es die Therapiesteuerung ermöglicht.
Bei Multipler Sklerose führt die Zerstörung der Nervenhüllen und der Nervenzellen selbst zu vielfältigen Symptomen, die alle Funktionen von Gehirn und Rückenmark beeinträchtigen können. Dazu zählen Sehstörungen wie unscharfes Sehen, Doppelbilder oder Gesichtsfeldausfälle, sensorische Beschwerden wie Kribbeln, Taubheit oder Ameisenlaufen in Gliedmaßen, Muskelschwäche, Gangunsicherheit, Spastik, Krämpfe, starke Ermüdbarkeit nach geringer Belastung, Koordinationsstörungen, Schwindel, Blasen- und Darmprobleme wie Harndrang, Inkontinenz oder Verstopfung, sexuelle Dysfunktionen sowie kognitive Einschränkungen wie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Depressionen oder Stimmungsschwankungen.
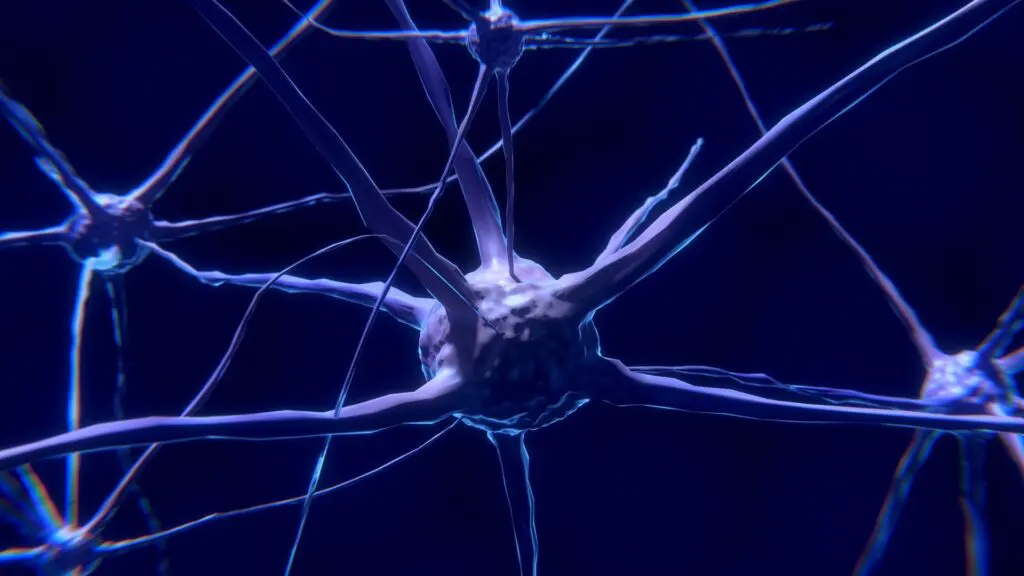
Aktuelle Studien unterstreichen, dass Veränderungen in der grauen Substanz maßgeblich für das Fortschreiten der Erkrankung verantwortlich sind, insbesondere für bleibende Behinderungen, kognitive Defizite und anhaltende Erschöpfung. Solche Läsionen prognostizieren zudem das Risiko einer Verschlechterung und den Übergang von schubförmigem zu kontinuierlich progredientem Verlauf. Die gängige Magnetresonanztomografie versagt jedoch bei der Darstellung der meisten dieser Veränderungen.
Die Positronen-Emissions-Tomografie könnte hier Abhilfe schaffen, wenn ein geeignetes Protein der Nervenzellen identifiziert wird, das sich nachweisen lässt und Rückschlüsse auf die Dichte der Neuronen und Synapsen erlaubt. In Experimenten hat das Team zunächst das Protein SV2A als Marker für die Synapsendichte bei Multipler Sklerose validiert. Anschließend injizierten die Forscher Mäusen mit einer MS-ähnlichen Hirnrindenentzündung eine schwach radioaktive Substanz, die spezifisch an SV2A bindet. Das Signal wurde per Tomografie erfasst und mit etablierten Methoden zur Synapsendichte verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Übereinstimmung, was in einer Folgestudie mit etwa 30 Patienten bestätigt wurde.
Das übergeordnete Ziel besteht darin, Therapien gezielt zu lenken, indem hochgefährdete Patienten früh erkannt und mit maßgeschneiderten Interventionen gegen das Fortschreiten behandelt werden. Als nächsten Schritt planen die Forscher Langzeitstudien, um zu prüfen, ob eine einzelne Untersuchung den langfristigen Krankheitsverlauf vorhersagen kann.
Original Paper:
Ullrich Gavilanes EM, Bartos LM, Gernert JA, Carral CA, Ruiz Navarro D, Havla J, Gerdes LA, Gnörich JS, Kunze LH, Dorneich JS, Pakula V, Tagnin L, Zimmermann H, Seelos K, Franzmeier N, Frontzkowski L, Pedrosa de Barros N, Ribbens A, Zwergal RM, Zwergal A, Vollmar C, Remi J, Picon C, Reynolds R, Merkler D, Wattjes MP, Kümpfel T, Brendel M, Kerschensteiner M. SV2A-PET imaging uncovers cortical synapse loss in multiple sclerosis. Sci Transl Med. 2025 Oct;17(818):eadt5585.
doi: 10.1126/scitranslmed.adt5585. Epub 2025 Oct 1. PMID: 41032626.
VORSCHAU: Der Deutsche Kongress für Laboratoriumsmedizin (DKLM) 2025 verspricht spannende Einblicke in die Schnittstelle von Wissenschaft und klinischer Praxis. Unter dem Leitmotiv „Science for Precision Medicine“ laden die Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (DGKL) sowie der Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V (DVTA) Fachleute aus Forschung, Klinik und Industrie ein, sich am 23. und 24. Oktober im Congress Center Leipzig (CCL) zu treffen. Der zweitägige Event richtet sich an Laborärzte, Biomedizinische Analytiker und Entscheidungsträger, um aktuelle Fortschritte in der Diagnostik zu diskutieren und Netzwerke zu stärken. Bereits am 22. Oktober findet die feierliche Eröffnung des Kongresses mit der Verleihung der MedLabAwards im Salles de Pologne statt.
Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR
Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.




