Bonner Forschende entdecken Mechanismus für postiktuales Umherwandern bei Epilepsie
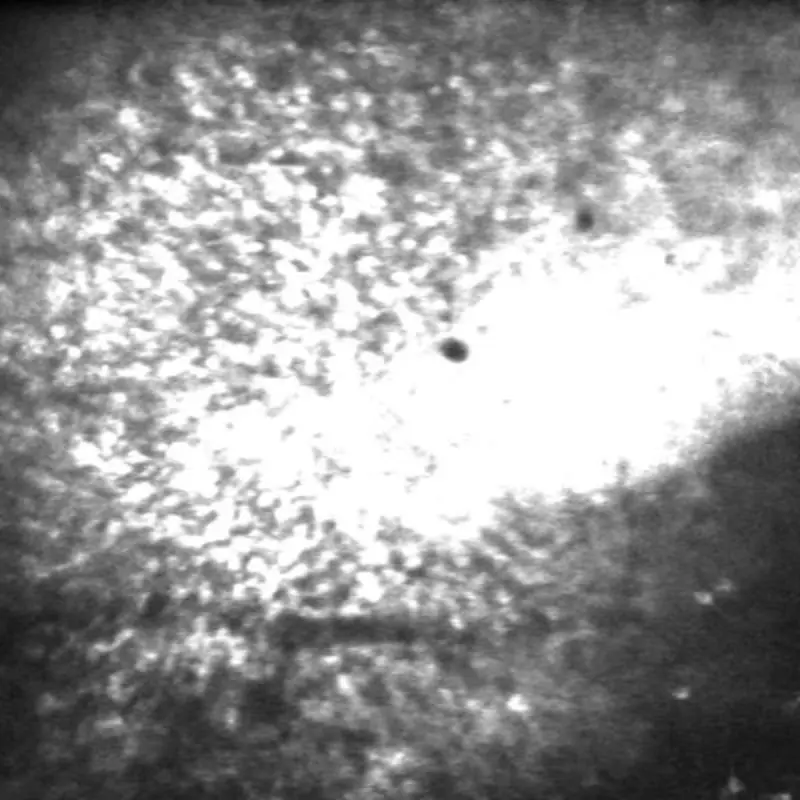
Forschende des Universitätsklinikums Bonn (UKB), der Universität Bonn und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) haben einen Mechanismus identifiziert, der das sogenannte postiktuale Umherwandern bei Menschen mit Schläfenlappenepilepsie auslöst. Dabei handelt es sich um Depolarisationswellen, bekannt als Spreading Depolarization (SD), die nach epileptischen Anfällen auftreten und neuronale Netzwerke für Minuten bis Stunden lahmlegen. Die Ergebnisse wurden in „Science Translational Medicine“ veröffentlicht.
Postiktuale Störungen wie Verwirrung, Sprachprobleme oder desorientiertes Umherlaufen treten nach epileptischen Anfällen auf und können lebensgefährlich sein, etwa wenn Betroffene orientierungslos auf die Straße laufen. Bisher galten die Anfälle selbst als Ursache. Die Bonner Studie zeigt jedoch, dass SD, die vor allem bei neurologischen Erkrankungen wie Migräne oder Gehirnverletzungen bekannt sind, die eigentliche Ursache sein könnten. Diese langsamen Wellen, die im klinischen Standard-EEG herausgefiltert werden, führen zu einem Zusammenbruch des neuronalen Membranpotentials, insbesondere im Hippokampus, einer für Epilepsie relevanten Hirnregion.
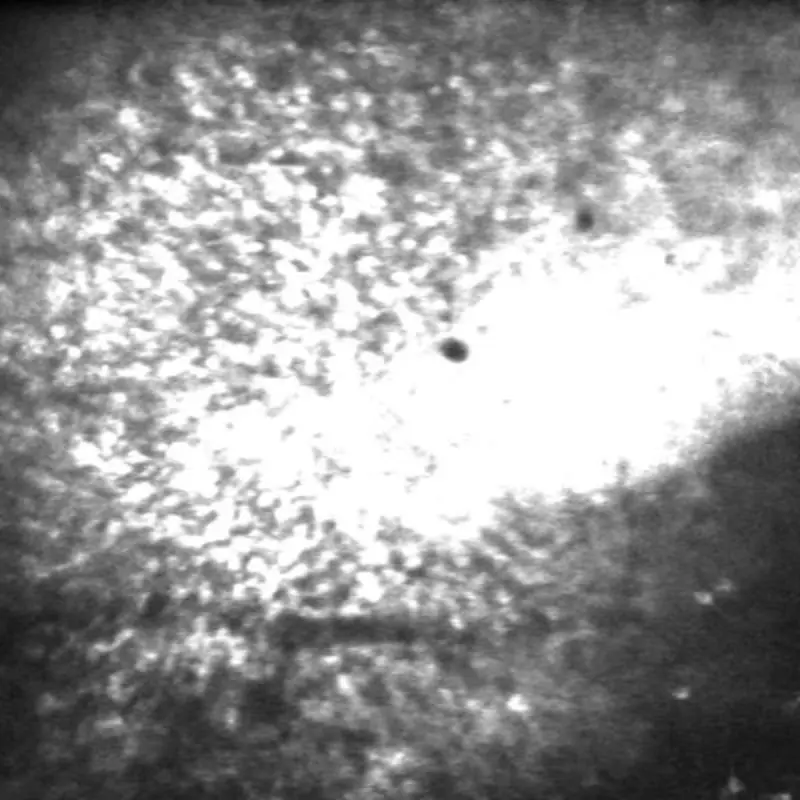
Die Entdeckung erfolgte im Mausmodell mittels hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie, Elektrophysiologie und Optogenetik, die Netzwerkdynamiken im lebenden Gehirn über Monate hinweg untersuchten. Ergänzend bestätigten Analysen mit Tiefenelektroden bei Patienten mit schwer behandelbarer Epilepsie, dass SD auch im menschlichen Gehirn nach Anfällen auftreten. Dafür wurde die EEG-Bandbreite über den Standard hinaus erweitert, um langsame Potentialschwankungen sichtbar zu machen.
Die Forschenden schlagen vor, dass SD eine zentrale Rolle bei postiktualen Störungen spielt und bisher unterschätzt wurde. Dies könnte erklären, warum solche Symptome besonders häufig bei Schläfenlappenepilepsien auftreten. Die Ergebnisse fordern eine Überprüfung bestehender Studien, da Effekte möglicherweise fälschlicherweise Anfällen zugeschrieben wurden. Zudem regen die Forschenden eine Debatte über eine Erweiterung des internationalen EEG-Standards an, um SD im klinischen Alltag sichtbar zu machen.
An der Studie waren neben dem UKB, der Universität Bonn und dem DZNE auch das Forschungszentrum Jülich, die RWTH Aachen, die Tierärztliche Hochschule Hannover und die University of California (USA) beteiligt.
Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR
Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.




