KI verbessert Risikoeinschätzung bei häufigster Herzinfarktform
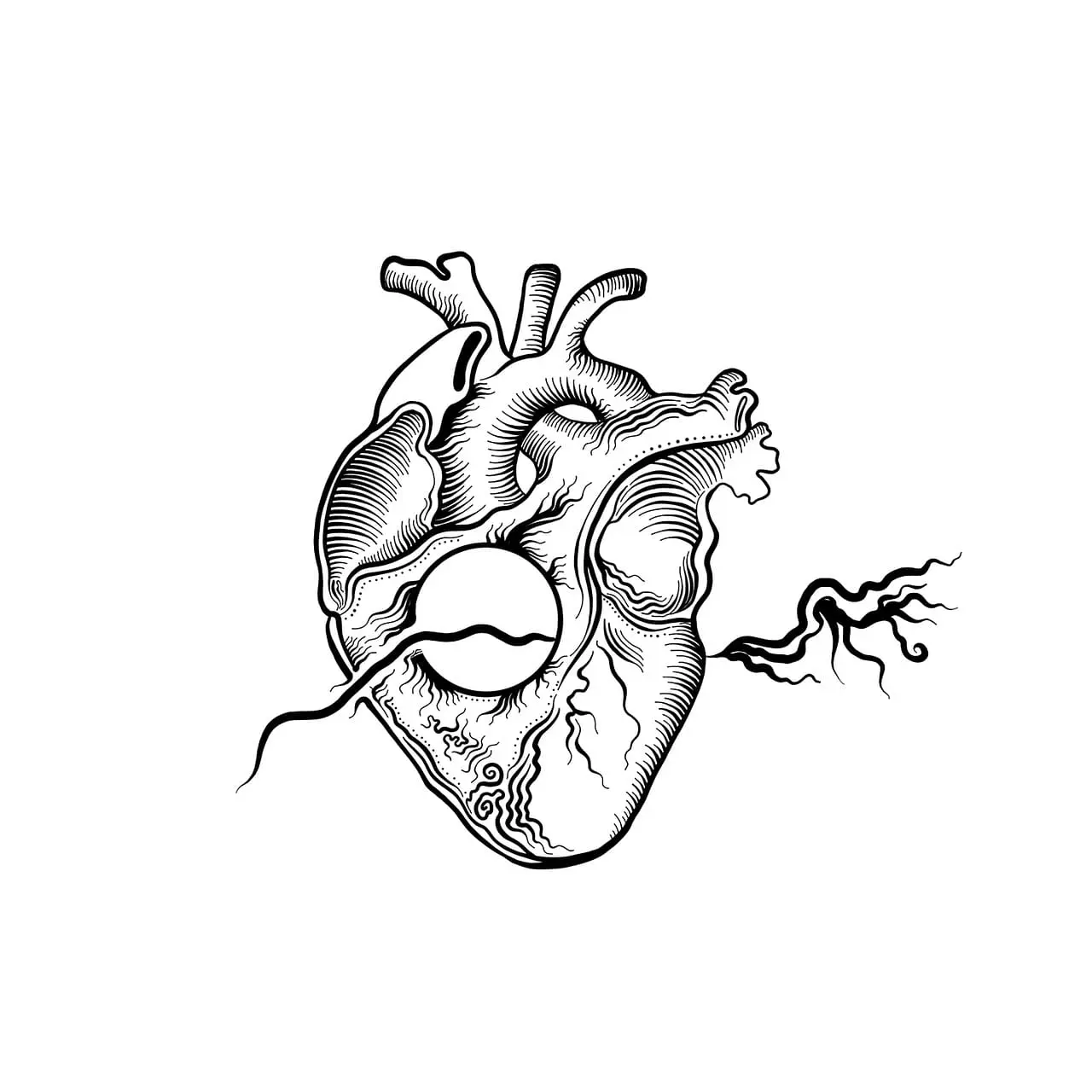
Künstliche Intelligenz ermöglicht eine präzisere Bewertung des Risikos bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom ohne ST-Hebung, der häufigsten Form des Herzinfarkts. Dadurch könnte die Behandlung gezielter gesteuert werden. Dies ergibt sich aus einer internationalen Studie unter Leitung der Universität Zürich, die in der Fachzeitschrift The Lancet Digital Health veröffentlicht wurde.
Ärzte nutzen bisher den etablierten GRACE-Score, um das Risiko einzuschätzen und den optimalen Zeitpunkt für eine Herzkatheter-Behandlung zu bestimmen. Dieser Score ist weltweit in klinische Leitlinien integriert, erfasst jedoch nicht die volle Komplexität der Erkrankung bei diesen Patienten.
In der Studie, die als die bisher größte zur Risikovorhersage bei dieser Herzinfarktform gilt, analysierte ein internationales Team unter Leitung der Universität Zürich Gesundheitsdaten von mehr als 600.000 Patienten aus zehn Ländern. Die klinischen Daten der VERDICT-Studie wurden erstmals mit Hilfe von KI ausgewertet. Das Modell wurde trainiert, um Patienten zu identifizieren, die besonders von einer frühen Herzkatheter-Behandlung, wie dem Einsetzen eines Stents, profitieren.
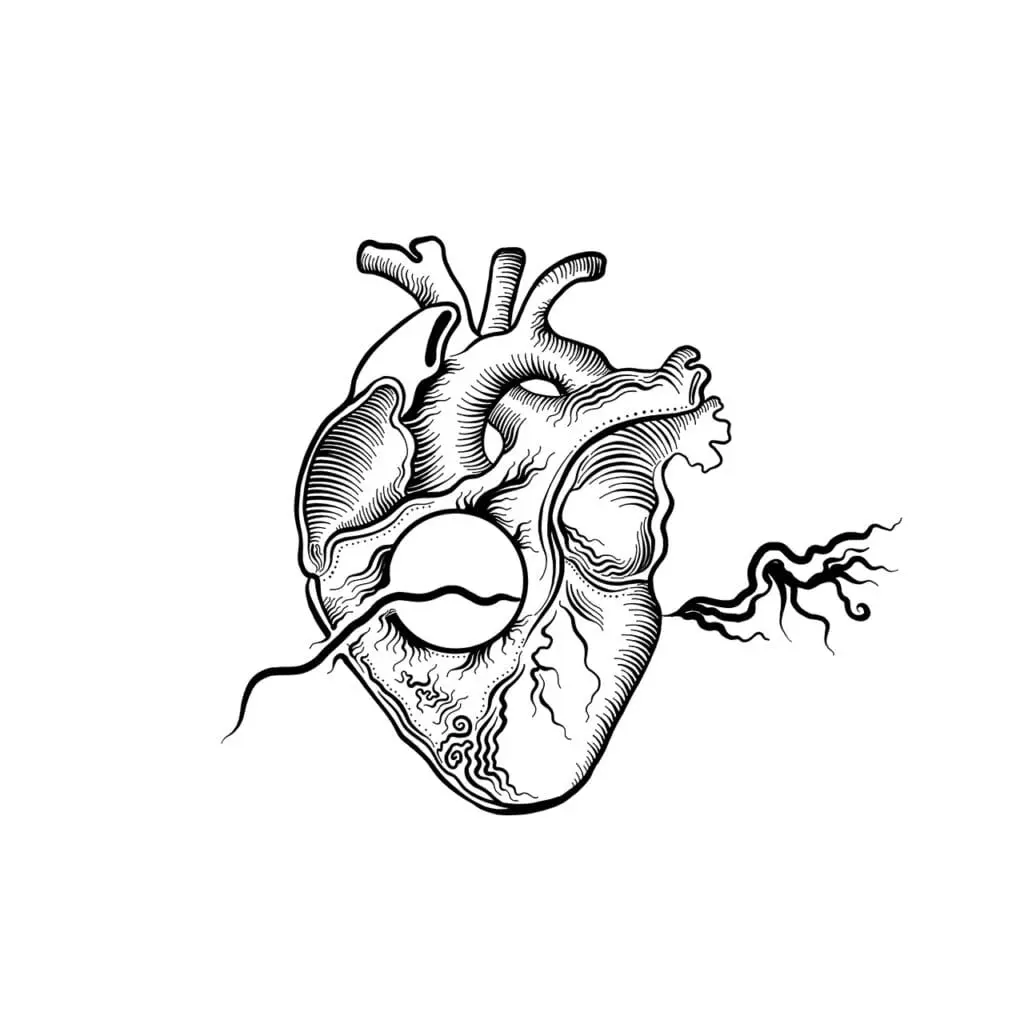
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Neubewertung vieler Patienten erforderlich sein könnte, mit potenziell großen Auswirkungen auf die globale Behandlung von Herzinfarkten. Während einige Patienten klar von einer frühen Intervention profitieren, zeigt sich bei anderen nur ein geringer oder kein Nutzen. Dies deutet an, dass aktuelle Strategien teilweise nicht die richtigen Patienten ansprechen. Eine umfassende Neustrukturierung der Versorgung, die den individuellen Nutzen bewertet, könnte notwendig werden.
Die Studie unterstreicht, wie KI die Herzinfarktbehandlung verändern kann. Durch die Analyse der Studiendaten hat das Modell gelernt, wer von einer frühen invasiven Behandlung profitiert und wer nicht. Dies könnte die Versorgung verbessern und die Herz-Kreislauf-Gesundheit nach dem Infarkt stärken.
Der neue GRACE 3.0-Score gilt als das fortschrittlichste und praktischste Instrument für die Behandlung dieser Patienten. Er ermittelt das Risiko genauer und dient als Hilfestellung für personalisierte Therapien. Die Forscher erwarten, dass dies künftige klinische Leitlinien beeinflussen und zur Rettung von Leben beitragen könnte.
Mit GRACE 3.0 wollen die Wissenschaftler Ärzten ein einfaches, validiertes und KI-basiertes Tool an die Hand geben, das in der Praxis unterstützt und eine individuellere sowie wirksamere Versorgung von Herzinfarkt-Patienten ermöglicht.
Original Paper:
VORSCHAU: Der Deutsche Kongress für Laboratoriumsmedizin (DKLM) 2025 verspricht spannende Einblicke in die Schnittstelle von Wissenschaft und klinischer Praxis. Unter dem Leitmotiv „Science for Precision Medicine“ laden die Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (DGKL) sowie der Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V (DVTA) Fachleute aus Forschung, Klinik und Industrie ein, sich am 23. und 24. Oktober im Congress Center Leipzig (CCL) zu treffen. Der zweitägige Event richtet sich an Laborärzte, Biomedizinische Analytiker und Entscheidungsträger, um aktuelle Fortschritte in der Diagnostik zu diskutieren und Netzwerke zu stärken. Bereits am 22. Oktober findet die feierliche Eröffnung des Kongresses mit der Verleihung der MedLabAwards im Salles de Pologne statt.
Redaktion: X-Press Journalistenbüro GbR
Gender-Hinweis. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppel/Dreifachnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.




